Metagenomics – Methods and Protocols – Dritte Ausgabe
2. November 2022, von Prof. Dr. Wolfgang Streit
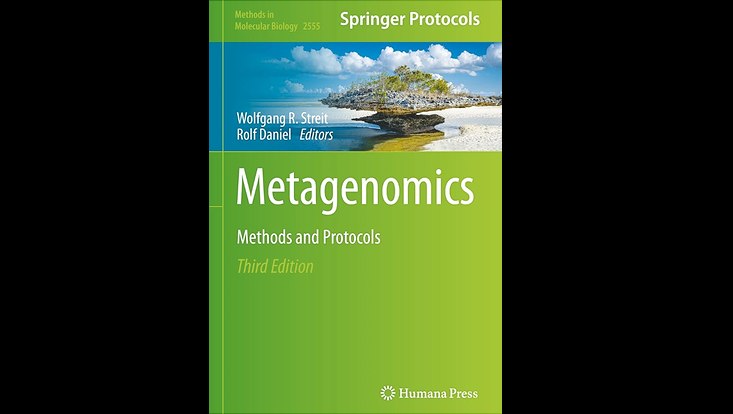
Foto: Humana Press
Die dritte Ausgabe des Buches „Metagenomics – Methods and Protocols“ ©2023 von Wolfgang R. Streit und Rolf Daniel beschreibt neue und umfangreiche Methoden und Anleitungen für vielfältige Anwendungsgebiete in der Arbeit mit metagenomischen Konzepten. Hierbei liegt der Fokus nicht bloß auf zukunftsweisende Gebiete, sondern auch auf Schritt für Schritt Protokolle für die praktische Anwendung innovativer Methoden.
Die Arbeitsgruppe „Mikrobiologie und Biotechnologie“ überarbeitete Kapitel, um diese auf den neusten Stand der Forschung zu bringen und veröffentlicht in der dritten Ausgabe drei neue Kapitel:
“Screening Metagenomes for Algae Cell Wall Carbohydrates Degrading Hydrolases in Enrichment Cultures”
Jascha F.H. Macdonald, Ines Krohn, Wolfgang R. Streit
DOI: 10.1007/978-1-0716-2795-2_9
Die effiziente Nutzung von Algen auf industriellem Niveau ist eine große Herausforderung der Zukunft, um einen neuartigen, nachhaltigen Rohstoff zu nutzen. Algen finden eine potentielle Anwendung in vielen Bereichen, unter anderem in der Energie-, Kosmetik- und Nahrungsindustrie sowie in medizinischen Anwendungsbereichen. Als Pflanzen besitzen Algenzellen eine Zellwand, aufgebaut aus einer Matrix verschiedenster Polysaccharide. Mithilfe von Metagenomanalysen, Anreicherungskulturen und verschiedenster metabolischen Untersuchungen entwickelten wir Methoden, um bakterielle Communities und Enzyme zu untersuchen und entdecken für einen effizienten Abbau der Zellwand Polymere. In optimierten in vitro Kulturen können bereits in wenigen Tagen hohe Raten an Abbau festgestellt werden
“The PET-Degrading Potential of Global Metagenomes: From In Silico Mining to Active Enzymes”
Jennifer Chow, Pablo Pérez-Garcia, Robert F. Dierkes, Hongli Zhang, Wolfgang R. Streit
DOI: 10.1007/978-1-0716-2795-2_10
Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Menge an Plastikmüll im Meer und an Land ist es wichtiger denn je, Auswege aus dieser Situation zu finden. In den letzten Jahren sind Mikroorganismen entdeckt worden, die in der Lage sind, künstliche Polymere wie Polyethylenterephthalat (PET) abzubauen. Auch wenn die Umsatzraten der für diese Reaktion verantwortlichen Enzyme möglicherweise zu gering sind, um das globale Problem der Plastikverschmutzung zu lösen, ist es dennoch von großem gesellschaftlichem Interesse, Mikroorganismen zu finden, die das Polymer abbauen können. Die entsprechenden Enzyme, PET-Esterasen (PETases), können in biotechnologischen Prozessen eingesetzt werden und könnten zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft beitragen. In diesem Kapitel stellen wir eine sequenzbasierte In-silico-Screening-Methode vor, um neue PETasen in metagenomischen Datensätzen zu finden. Diese Methode kann leicht angepasst werden, um andere Enzymklassen zu finden. Wir führen auch eine Reihe von Assays auf, mit denen die Enzyme auf ihre Aktivität für PET und andere Substrate getestet werden können.
“Metagenomic Screening of a Novel PET Esterase via In Vitro Expression System”
Yuchen Han, Robert F. Dierkes, Wolfgang R. Streit
DOI: 10.1007/978-1-0716-2795-2_12
Das metagenomische Screening ist ein weit verbreiteter biotechnologischer Ansatz für das Screening neuer industrieller Enzyme. Die traditionelle Methode des metagenomischen Screenings basiert auf der Funktionsanalyse heterolog exprimierter Umweltgene in einem geeigneten Wirt, was den Engpass dieser Methode darstellt. Um die Einschränkungen des klonabhängigen Systems zu umgehen, wurde eine In-vitro-Expressionstechnologie in Kombination mit Next-Generation-Sequencing und Bioinformatik entwickelt. Zunächst wird das Sequenzprofil eines Zielenzyms, z. B. der Poly(ethylenterephthalat)esterase in diesem Protokoll, anhand der Sequenzen gut charakterisierter Enzyme erstellt. Dann wird das Sequenzscreening mit diesem rechnerisch erstellten Profil unter allen verfügbaren metagenomischen Datenbanken durchgeführt. Anschließend werden die Kandidatengene synthetisiert und in vitro mit RNA-Polymerase und Translationsmaschinerie aus einem speziellen Zellextrakt exprimiert. Schließlich werden diese in vitro produzierten Enzyme direkt für die Funktionsanalyse verwendet. Im Vergleich zu den herkömmlichen Screening-Methoden kann diese In-vitro-Screening-Technologie nicht nur Zeit und Material einsparen, sondern auch leicht für ein Hochdurchsatz-Screening mit einem automatischen Pipettierroboter entwickelt werden.


