Bachelor-Studium auf Lehramt
Im BA/BSc-Studium auf Lehramt bieten wir das Lehrmodul "Biodiversität der Pflanzen" an, mit Vorlesungen auf Lecture2Go im Wintersemester und praktischen Lehrveranstaltungen im darauffolgenden Sommersemester.
Biodiversität der Pflanzen
- Ansprechpartner: Jens G. Rohwer( Jens.Rohwer"AT"uni-hamburg.de)
- Zielgruppen: Studierende aller Lehramtsstudiengänge, 3. und 4. Sem.; Studierende mit Biologie als Nebenfach
61-710 Übersicht über das Pflanzenreich (Vorlesung)
Dieter Hanelt, Jens G. Rohwer
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wichtigsten Gruppen von Organismen, welche traditionell Gegenstand der Botanik sind (also mehr als nur „Pflanzen“): Cyanobakterien („Blaualgen“), die wichtigsten Algengruppen, Moose, farnartige Pflanzen, Nacktsamer (Gymnospermen), Bedecktsamer (Angiospermen), sowie die wichtigsten Pilzgruppen einschließlich der Flechten. Die Grundfragen dabei lauten:
- Welches sind die wichtigsten Entwicklungslinien?
- Wie kann man sie erkennen und unterscheiden?
- Wie pflanzen sie sich fort?
- Wie bezeichnet man ihre wichtigsten Strukturen?
- Wie sind sie miteinander verwandt?
- Was macht eine Gruppe erfolgreicher als eine andere?

Foto: UHH/Rohwer
Cyanobakterium Anabaena azollae, mit Heterocyten; lichtmikroskopisches Bild
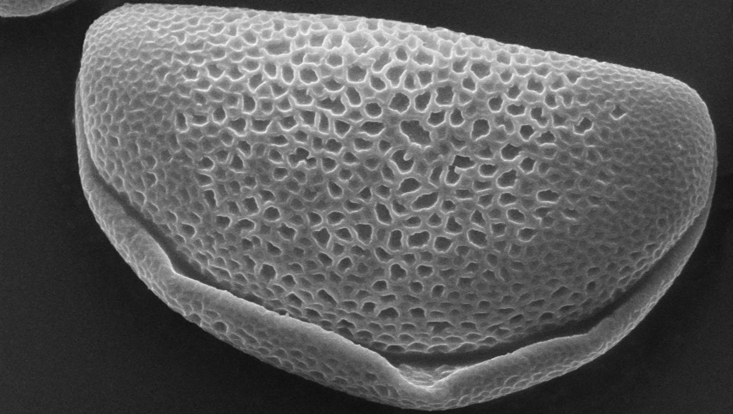
Foto: UHH/Rohwer
Pollenkorn von Clivia, im Rasterelektronenmikroskop

Foto: UHH/Rohwer
Spitze des Stamms eines Palmfarns (Cycas circinalis), mit Fruchtblättern

Foto: UHH/Rohwer
Eine der häufigsten heimischen Flechten, Xanthoria parietina, mit Apothecien

Foto: UHH/Rohwer
Folioses Lebermoos Lophocolea heterophylla, mit Sporogonen

Foto: UHH/Rohwer
Zweig der Eibe (Taxus baccata) mit männlichen Zapfen

Foto: UHH/Rohwer
Rotalge Delesseria sanguinea, aus dem Algenherbarium Rohwer

Foto: UHH/Rohwer
Antheridienstände eines Frauenhaarmoses, Polytrichum spec.

Foto: UHH/Rohwer
Zweige von Ephedra distachya mit Samen zwischen fleischigen Schuppen

Foto: UHH/Rohwer
Längsschnitt durch den Fruchtknoten einer Narzisse (Narcissus pseudonarcissus)

Foto: UHH/Rohwer
Samenzapfen und Blütenzapfen der Lärche (Larix decidua); männliche Zapfen gelb, weibliche rot

Foto: UHH/Rohwer
Torfmoos (Sphagnum spec.) mit Sporogonen

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtkörper eines Fliegenpilzes (Amanita muscaria, Basidiomycetes)

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtkörper (Apothecien) des Schmutzbecherlings (Bulgaria inquinans, Ascomycetes)

Foto: UHH/Rohwer
Laubmoos mit Sporogonen

Foto: UHH/Rohwer
Embryo einer Erbse (Pisum sativum), ein Keimblatt abpräpariert

Foto: UHH/Rohwer
Blüte von Amborella trichopoda, Schwestergruppe zu allen übrigen Angiospermen (auch als "ursprünglichste lebende Angiosperme" bezeichnet)

Foto: UHH/Rohwer
Blasentang Fucus vesiculosus (Braunalgen, Phaeophyceae); Ostsee

Foto: UHH/Rohwer
Weiblicher Zapfen einer Zypresse (Cupressus sp.) mit Bestäubungstropfen auf röhrenförmigen Mikropylen

Foto: UHH/Rohwer
Grünalge Ulva intestinalis; Nordsee

Foto: UHH/Rohwer
Unreifer Zapfen von Larix decidua, links Längsschnitt, rechts Samenschuppe mit zwei jungen Samen

Foto: UHH/Rohwer
Rhizoid des Laubmooses Dicranoweisia cirrata; lichtmikroskopisches Bild
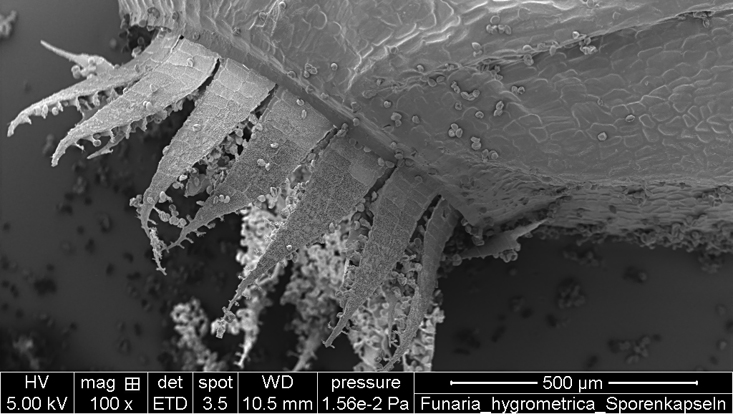
Foto: UHH/Rohwer
Peristomzähne des Drehmoses Funaria hygrometrica, im Rasterelektronenmikroskop
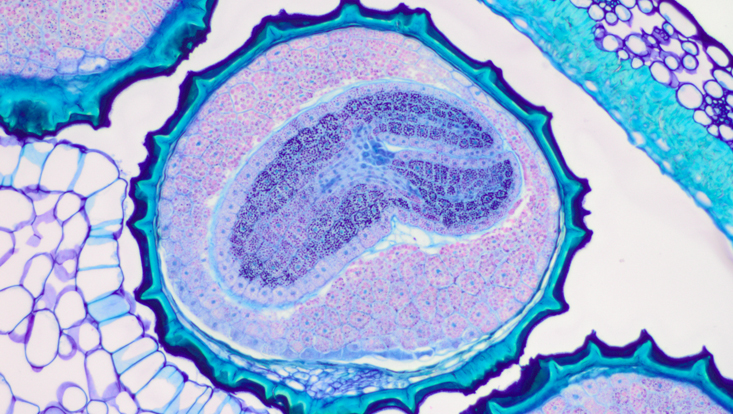
Foto: UHH/Rohwer
Querschnitt durch die Frucht einer Petunie (Petunia axillaris), mit Längsschnitt durch einen Samen
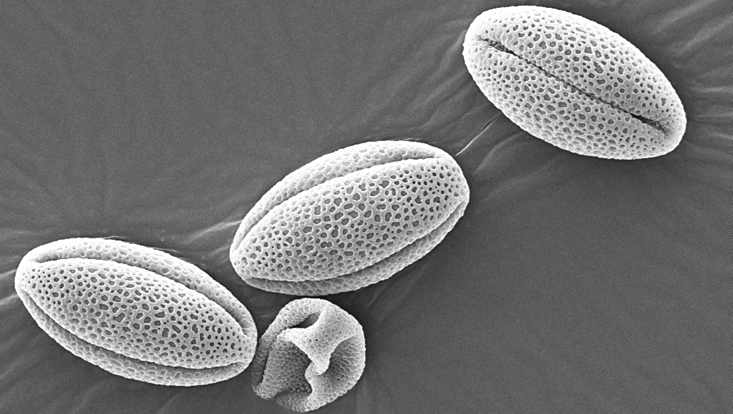
Foto: UHH/Rohwer
Pollenkörner von Streptocarpus, im Rasterelektronenmikroskop
61-711 Morphologie und Systematik heimischer Gefäßpflanzen (Vorlesung)
Jens G. Rohwer
Diese Vorlesung vermittelt die wichtigsten Grundlagen, um sich in der heimischen Flora zurechtzufinden. Themen sind:
- Die wichtigsten Strukturen der Blütenpflanzen
- Fachbegriffe zu deren Beschreibung und Bestimmung
- Die wichtigsten heimischen Pflanzenfamilien und wie man sie erkennt
- Die wichtigsten Nutzpflanzen aus diesen Gruppen

Foto: UHH/Rohwer
Allorhize (links) und homorhize (rechts) Bewurzelung

Foto: UHH/Rohwer
Speicherwurzeln (Campanula rapunculoides, links) und Wurzelknollen (Ficaria verna, rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Dichasialer Sprossaufbau beim Flieder (Syringa vulgaris)

Foto: UHH/Rohwer
Sprossdorn der Schlehe (Prunus spinosa) mit Blütenknospen

Foto: UHH/Rohwer
Phyllocladien (blattähnliche Sprosse) des Mäusedorns (Ruscus aculeatus), rechts mit weiblicher Blüte

Foto: UHH/Rohwer
Windende Sprosse des Hopfens (Humulus lupulus, links) und rankende Sprosse der Weinrebe (Vitis vinifera, rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Rhizom (unterirdischer Speicherspross) des Buschwindröschens (Anemone nemorosa)

Foto: UHH/Rohwer
Ausläufer des Gänsefingerkrauts (Potentilla anserina)

Foto: UHH/Rohwer
Sprossknollen (Ausläuferknollen) der Kartoffel (Solanum tuberosum)

Foto: UHH/Rohwer
Grundformen der Blattstellung: wechselständig: 1 Blatt pro Knoten (Veronica filiformis, links), gegenständig: 2 Blätter pro Knoten (Stellaria graminea, Mitte), wirtelig: > 2 Blätter pro Knoten (Hippuris vulgaris, rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Spezialfälle wechselständiger Blattstellung: zweizeilig (Phalaris arundinacea, links), dreizeilig (Veratrum album, Mitte), spiralig, hier eine 3/8-Spirale (Hypochaeris radicata, rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Limitdivergenz-Spiralen (ca. 137,5°) des Romanesco-Kohls (Brassica oleracea var. botrytis)

Foto: UHH/Rohwer
Bildungen des Blattgrunds: links Nebenblätter = Stipeln (Malus spec.), rechts Blattscheiden (Angelica archangelica)

Foto: UHH/Rohwer
Grundformen der Blattnervatur: links parallelnervig (Deschampsia caespitosa), rechts fiedernervig (Carpinus betulus)

Foto: UHH/Rohwer
Blattränder: (v.l.n.r.) ganzrandig (Syringa vulgaris), gesägt (Forsythia intermedia), stachelig gezähnt (Mahonia aquifolium), gekerbt (Glechoma hederacea), gebuchtet (Quercus petraea)

Foto: UHH/Rohwer
Handförmig geteilte Blätter der Moschusmalve (Malva moschata)

Foto: UHH/Rohwer
Gefiedertes Blatt einer Wicke (Vicia spec.), mit Nebenblättern und Blattranken

Foto: UHH/Rohwer
Vielzählig gefingerte Blätter der Blauen Lupine (Lupinus polyphyllus)

Foto: UHH/Rohwer
Razemöse Blütenstände: (v.l.n.r.) Traube (Brassica napus), Ähre (Orobanche hederae), Dolde (Astrantia major), Köpfchen (Scabiosa lucida)

Foto: UHH/Rohwer
Zymöse Blütenstände: rechts Dichasium (Stellaria holostea), links Wickel (Symphytum officinale)

Foto: UHH/Rohwer
Komplexe Blütenstände: (v.l.n.r.) Rispe (Ligustrum vulgare), Spirre (Filipendula ulmaria), Thyrsus (Aesculus hippocastanum)

Foto: UHH/Rohwer
Blütenstände (Kätzchen) von Pappeln (Populus spec.), links weiblich, rechts männlich

Foto: UHH/Rohwer
Blüte eines Gelbsterns (Gagea lutea), mit Perigon = Blütenhülle aus gleichartigen Organen

Foto: UHH/Rohwer
Blüte des Feld-Sparks (Spergula arvensis), mit doppelter Blütenhülle

Foto: UHH/Rohwer
Blüten der Gewöhnlichen Esche (Fraxinus excelsior), ohne Blütenhülle

Foto: UHH/Rohwer
Blüte der Heidenelke (Dianthus deltoides): radiärsymmetrisch = mit mehr als 2 Symmetrieebenen

Foto: UHH/Rohwer
Blüten des Tränenden Herzens (Lamprocapnos spectabilis): disymmetrisch = mit genau 2 senkrecht aufeinander stehenden Symmetrieebenen

Foto: UHH/Rohwer
Blüten des Gewöhnlichen Augentrosts (Euphrasia officinalis): zygomorph = mit nur einer Symmetrieebene

Foto: UHH/Rohwer
Gespornte Blüte des Hohlen Lerchensporns (Corydalis cava); Sporn von Hummeln aufgebissen, um an den Nektar zu gelangen

Foto: UHH/Rohwer
Blüten des Buschwindröschens (Anemone nemorosa), mit polymerem Androeceum

Foto: UHH/Rohwer
Blüten mit diplostemonem Androeceum = mit doppelt so vielen Stamina wie Kronblättern (Oxalis corniculata, links) und mit haplostemonem Androeceum = mit ebenso vielen Stamina wie Kronblättern (Sambucus nigra, rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Öffnungsweisen von Antheren: longizid = längs aufreißend (Lilium martagon, links); porizid = mit eng begrenzter Öffnung (Solanum tuberosum, Mitte); valvat = mit Klappen (Mahonia aquifolium, rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Verwachsungen der Filamente: links mit der Kronröhre = Bildung eines Stamen-Corollentubus (Syringa vulgaris); rechts miteinander = Bildung einer Filamentröhre (Malva moschata)

Foto: UHH/Rohwer
Gynoeceum: links chorikarp = aus mehreren freien Karpellen (Helleborus niger), rechts coenokarp = aus mehreren (hier 3) verwachsenen Karpellen (Tropaeolum majus)

Foto: UHH/Rohwer
Gynoeceum: links oberständig = oberhalb des Ansatzpunkts der übrigen Blütenorgane (Hyacinthoides non-scripta), rechts unterständig = unterhalb des Ansatzpunktes der übrigen Blütenorgane (Galanthus nivalis)

Foto: UHH/Rohwer
Plazentation bei chorkarpem Gynoeceum: links submarginal (Aquilegia vulgaris), Mitte und rechts laminal (Nymphaea spp.), Mitte im Querschnitt, rechts im Längsschnitt

Foto: UHH/Rohwer
Plazentation bei coenokarpem Gynoeceum: links zentralwinkelständig (Tulipa gesneriana), rechts parietal (Menyanthes trifoliata)

Foto: UHH/Rohwer
Frei zentrale Plazentation bei Primula veris, links Längsschnitt durch Fruchtknoten zur Blütezeit, rechts Querschnitt durch junge Frucht

Foto: UHH/Rohwer
Offene Balgfrucht des Winterlings (Eranthis hyemalis)

Foto: UHH/Rohwer
Hülsenfrüchte der Saatwicke (Vicia sativa), links noch geschlossen, rechts geöffnet

Foto: UHH/Rohwer
Monokarpellate Beerenfrüchte der Berberitze (Berberis thunbergii)

Foto: UHH/Rohwer
Steinfrucht des Pfirsichs (Prunus persica), Längsschnitt

Foto: UHH/Rohwer
Nüsschenfrucht des Gift-Hahnefuß (Ranunculus sceleratus)

Foto: UHH/Rohwer
Fleischige Nüsschenfrüchte ("Sammelfrüchte"), links Erdbeere (Fragaria x ananassa), Blütenboden fleischig; rechts Hagebutte der Kartoffelrose (Rosa rugosa), Blütenbecher (Hypanthium) fleischig

Foto: UHH/Rohwer
Steinfrüchtchenfrucht ("Sammelfrucht") der Himbeere (Rubus idaeus); Kelchblätter, Stamina und Griffel noch erhalten

Foto: UHH/Rohwer
Lokulizide Kapseln der Wasserschwertlilie (Iris pseudacorus)

Foto: UHH/Rohwer
Septizide Kapsel des Roten Fingerhuts (Digitalis purpurea)

Foto: UHH/Rohwer
Kapseln mit besonderer Öffungsweise, links Zähnchenkapsel von Silene dioica, Mitte Porenkapsel von Papaver dubium, rechts Deckelkapseln von Plantago lanceolata

Foto: UHH/Rohwer
Schoten des Goldlacks (Erysimum cheiri)

Foto: UHH/Rohwer
Beere der Tomate (Lycopersicon esculentum), Längsschnitt

Foto: UHH/Rohwer
Querschnitt durch eine Olive, die aus zwei Karpellen entstandene Steinfrucht des Ölbaums (Olea europaea); in Kunststoff eingebettet

Foto: UHH/Rohwer
Nussfrüchte mit Cupula der Stieleiche (Quercus robur)

Foto: UHH/Rohwer
Flügelnüsse der Bergulme (Ulmus glabra)

Foto: UHH/Rohwer
Klausenfrucht des Wolfsauges (Anchusa arvensis)

Foto: UHH/Rohwer
Spaltfrüchte, von links nach rechts: Stockrose (Alcea rosea), Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
61-713 Bestimmungsübungen an höheren Pflanzen (Praktikum)
Jens G. Rohwer, Stefan Rust
Schüler, Eltern und Kollegen erwarten ganz selbstverständlich, dass Biologie-Lehrer/innen heimische Pflanzen erkennen oder bestimmen können. Wir zeigen Ihnen, wie das geht, und geben Ihnen Gelegenheit zum Üben und Vertiefen Ihrer Kenntnisse. Die dazu notwendige Terminologie wird in der Vorlesung „Morphologie und Systematik heimischer Gefäßpflanzen“ vermittelt.

Foto: UHH/Rohwer
Infloreszenzen der Liliaceae: Einzelblüte (Fritillaria meleagris), Traube (Lilium martagon), Doldentraube (Fritillaria imperialis)

Foto: UHH/Rohwer
Blüten der Liliaceae, links Tulipa sylvestris, rechts Lilium bulbiferum, radiär, mit 3+3 (nahezu) gleichen, freien Perigonblättern, 3+3 Stamina und einem oberständigen, aus drei Karpellen verwachsenen Fruchtknoten

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtknoten von Tulipa gesneriana, links seitlich gesehen, rechts im Querschnitt

Foto: UHH/Rohwer
Früchte von Liliaceae: lokulizide Kapseln, links Tulipa gesneriana, rechts Lilium regale

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Asparagaceae: links Anthericum liliago, mit freien Tepalen, rechts Polygonatum multiflorum, mit verwachsenen Tepalen

Foto: UHH/Rohwer
Früchte von Asparagaceae: links lokulizide Kapseln von Muscari botryoides, rechts Beeren von Convallaria majalis

Foto: UHH/Rohwer
Infloreszenzen der Amaryllidaceae: vielblütige Dolde (Allium flavum); zweiblütige Dolde (Leucojum vernum); Einzelblüte = einblütige Dolde (Galanthus nivalis)

Foto: UHH/Rohwer
Infloreszenzen der Asparagaceae: rechts Einzelblüte (Asparagus officinalis), links Traube (Muscari latifolium)

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Amaryllidaceae: links Dichternarzisse (Narcissus poeticus), mit gelb-roter Nebenkrone; rechts Bärlauch (Allium ursinum), mit oberständigem Fruchtknoten, Ausnahme innerhalb der Familie

Foto: UHH/Rohwer
Blüte des Schneeglöckchens (Galanthus nivalis, Amaryllidaceae), Längsschnitt; Fruchtknoten unterständig

Foto: UHH/Rohwer
Früchte von Amaryllidaceae: rechts lokulizide Kapsel (Narcissus pseudonarcissus), links Übergangsform zwischen Kapsel und Beere (Galanthus nivalis)

Foto: UHH/Rohwer
Nutzpflanzen aus den Amaryllidaceae: links Küchenzwiebel (Allium cepa), Längsschnitt; Mitte Schnittlauch (Allium schoenoprasum); rechts Lauchstange (Allium porrum)

Foto: UHH/Rohwer
Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)

Foto: UHH/Rohwer
Blätter von Ranunculaceae, links ungeteiltes Blatt von Caltha palustris, rechts doppelt gefiedertes Blatt von Actaea racemosa

Foto: UHH/Rohwer
Tief handförmig geteiltes Blatt (Ranunculus repens, Ranunculaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Hochblätter unter einfacher Blütenhülle (Helleborus niger, Ranunculaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Blüten der Schneerose (Helleborus niger, Ranunculaceae), mit tütenförmigen Nektarblättern zwischen Blütenhülle und Androeceum

Foto: UHH/Rohwer
Nektarblätter als Kronblätter beim Scharfen Hahnenfuß ( Ranunculus acris, Ranunculaceae), links ganze Blüte, rechts herausgezupftes Nektarblatt

Foto: UHH/Rohwer
Ranunculaceae: Blüte von Aquilegia vulgaris, mit fünf kronblattartigen, tütenförmigen, gespornten Nektarblättern

Foto: UHH/Rohwer
Zygomorphe Blüten bei Ranunculaceae; links gespornt bei Consolida regalis, rechts helmförmig bei Aconitum lycoctonum

Foto: UHH/Rohwer
Blüten einer Gartenform des Hohen Rittersporns (Delphinium elatum); links Teilblütenstand, rechts Längsschnitt durch eine Blüte, mit tütenförmigem, in den Sporn reichenden Nektarblatt, eines herauspräpariert

Foto: UHH/Rohwer
Die häufigsten Fruchttypen der Ranunculaceae: links Nüsschenfrucht (Ranunculus sceleratus), rechts Balgfrucht (Eranthis hyemalis)

Foto: UHH/Rohwer
Nüsschenfrucht mit stark behaarten Griffeln (Clematis vitalba, Ranunculaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Christophskraut (Actaea spicata) - Ausnahme unter den Ranunculaceae mit nur einem Karpell pro Blüte und Beerenfrüchten

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae: Blattbasen mit Nebenblättern, links Malus spec., rechts Sorbus aucuparia

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae: Blüten mit Außenkelch, links Potentilla neumanniana, rechts Fragaria ananassa

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Rosaceae, links typischer Blütenbau der Familie bei Rosa multiflora, rechts stark reduzierte Blüten im Köpfchen von Sanguisorba minor

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae, Längsschnitte durch Blüten: links Rosa rugosa, Karpelle im Hypanthium eingeschlossen; rechts Geum rivale, Karpelle auf Gynophor emporgehoben

Foto: UHH/Rohwer
Positionen der Fruchtknoten bei Rosaceae: links oberständig (Fragaria moschata), Mitte mittelständig (Prunus serotina), rechts unterständig (Malus domestica)

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae: Balgfrüchte von Physocarpus opulifolius

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae, besondere Nüsschenfrüchte: links Geum urbanum, mit Griffeln als Widerhaken, rechts Filipendula ulmaria, gedrehte Nüsschen

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae: Steinfrüchtchenfrüchte, links Rubus saxatilis, rechts Rubus caesius

Foto: UHH/Rohwer
Rosaceae: Fleischige Nüsschenfrüchte ("Sammelfrüchte"), links Erdbeere (Fragaria x ananassa), Blütenboden fleischig; rechts Hagebutte der Kartoffelrose (Rosa rugosa), Blütenbecher (Hypanthium) fleischig

Foto: UHH/Rohwer
Längsschnitte durch fleischige Früchte bei Rosaceae, links unterständige Beere (Apfel, Malus domestica), rechts Steinfrucht (Aprikose, Prunus armeniaca)

Foto: UHH/Rohwer
Boraginaceae: raue Behaarung bei Achusa azurea (links) und Symphytum officinale (rechts)

Foto: UHH/Rohwer
Boraginaceae: Wickel von Myosotis arvensis

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Pentaglottis sempervirens (Boraginaceae); herausgestülpte Schlundschuppen gut erkennbar

Foto: UHH/Rohwer
Zygomorphe Blüten (Ausnahme!) bei Boraginaceae: links Echium vulgare, rechts Anchusa arvensis

Foto: UHH/Rohwer
Boraginaceae: Blüte von Symphytum officinale, längs aufgeschlitzt; Schlundschuppen und Stamina einander abwechselnd

Foto: UHH/Rohwer
Unreife Klausenfrucht von Pentaglottis sempervirens (Boraginaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Bilder von vierkantige Stängel und gegenständigen Blättern bei Lamiaceae, links Lamium purpureum, rechts und Lycopus europaeus

Foto: UHH/Rohwer
Lamiaceae: typische zygomorphe Blüten von Galeopsis bifida

Foto: UHH/Rohwer
Längsschnitt durch die Blüte von Lamium maculatum (Lamiaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Blüte von Teucrium chamaedrys (Lamiaceae), seitlich gesehen; Oberlippenzipfel zur Seite gerückt, daher Blüte ohne Oberlippe

Foto: UHH/Rohwer
Kelche von Leonurus cardiaca (Lamiaceae), mit fast reifen Klausen

Foto: UHH/Rohwer
Halophytische Brassicaceae, links Meerkohl (Crambe maritima), rechts Meersenf (Cakile maritima)

Foto: UHH/Rohwer
Stängelblätter von Brassicaceae; links Capsella bursa-pastoris, ungeteilt, stängelumfassend-sitzend; Mitte Barbarea vulgaris, tief fiederteilig, sitzend, geöhrt; rechts Lunaria annua, herzförmig, gestielt

Foto: UHH/Rohwer
Typischer Blütenstand der Brassicaceae: tragblattlose Traube; links Arabidopsis thaliana, rechts Brassica napus

Foto: UHH/Rohwer
Typische Kreuzblüten von Brassicaceae, K4 C4 A2+4 G(2); links Rorippa sylvestris, rechts Cardamine amara

Foto: UHH/Rohwer
Früchte von Brassicaceae, links geschnäbelte Schote von Eruca sativa, rechts Schötchen von Thlaspi arvense

Foto: UHH/Rohwer
Wurzeln von Trifolium dubium mit Wurzelknöllchen

Foto: UHH/Rohwer
Blätter von Fabaceae; links Trifolium dubium, mit Nebenblättern (Stipeln), rechts Phaseolus vulgaris, mit Nebenblättchen (Stipellen)

Foto: UHH/Rohwer
Fabaceae: gefiedertes Blatt von Vicia sativa, mit Blattfiederranken

Foto: UHH/Rohwer
Infloreszenzen von Fabaceae; links köpfchenartige Doldentraube von Trifolium badium, rechts Traube von Melilotus albus

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Fabaceae; links Ornithopus perpusillus, rechts Lupinus polyphyllus, Flügel und ein Blatt des Schiffchens entfernt, Filamentröhre freigelegt

Foto: UHH/Rohwer
Früchte von Vicia sativa (Fabaceae); links geschlossen, rechts aufgesprungen

Foto: UHH/Rohwer
Blätter verschiedener Caryophyllaceae; links häufigster Fall, gegenständig, sitzend, ohne Stipeln, scheinbar 1-nervig (Cerastium fontanum); Mitte scheinquirlig (Spergula arvensis); rechts mit häutigen interpetiolären Stipeln (Spergularia rubra)

Foto: UHH/Rohwer
Blütenstand (Dichasium) des Wasserdarms (Stellaria aquatica)

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Caryophyllaceae; links mit freien Kelchblättern (Spergularia rubra), rechts mit verwachsenen Kelchblättern (Silene vulgaris)

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Silene dioica, längs aufgerissen; links weiblich, rechts männlich

Foto: UHH/Rohwer
Zähnchenkapsel von Cerastium fontanum

Foto: UHH/Rohwer
Alopecurus pratensis (Poaceae), links obere Ende der Blattscheide mit Ligula, rechts Längsschnitt durch Halm mit Knoten

Foto: UHH/Rohwer
Rispenast des Wiesenripsengrases (Poa pratensis, Poaceae), mit blühenden Ährchen

Foto: UHH/Rohwer
Ährchen von Poaceae, seitlich gesehen, links Bromus secalinus, mit begrannten Deckspelzen und unbegrannten Hüllspelzen, rechts Briza media, mit unbegrannten Spelzen

Foto: UHH/Rohwer
Ährchen und Blütenteile von Festuca rubra (Poaceae); links drei geschlossene Blüten, eine Deckspelze (mit Granne) und eine Vorspelze (ohne Granne) abpräpariert; Mitte und rechts je eine Blüte ohne ihre Spelzen

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtende Ährchen des Glatthafers (Arrhenatherum elatius, Poaceae), mit geknieten Grannen

Foto: UHH/Rohwer
Blätter und Stängel von Juncaceae, links Luzula campestris, mit behaarter Blattscheide; Mitte Juncus effusus, stielrundes Blatt längs aufgeschnitten; rechts Juncus articulatus

Foto: UHH/Rohwer
Blütenstand der Feld-Hainsimse (Luzula campestris, Juncaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Juncus tenuis (Juncaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtstand von Juncus inflexus (Juncaceae)

Foto: UHH/Rohwer
Details von Carex hirta (Cyperaceae): links Stängel mit Blattscheiden und Blattbasen, Mitte weibliches Ährchen, rechts männliches Ährchen

Foto: UHH/Rohwer
Schoenoplectus lacustris (Cyperaceae): links Basis des Stängels, Mitte längs aufgeschnittener Stängel, rechts Stängelspitze mit blühenden Ährchen

Foto: UHH/Rohwer
Scirpus silvaticus (Cyperaceae): links Blütenstand (Spirre), rechts Detail des Blütenstandes

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtende Ährchen von Carex (Cyperaceae), links C. pseudocyperus, rechts C. riparia

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtstände von Eriophorum (Cyperaceae), links E. angustifolium, rechts E. vaginatum

Foto: UHH/Rohwer
Plantaginaceae: links Misopates orontium, Mitte Digitalis grandiflora, rechts Globularia cordifolia

Foto: UHH/Rohwer
Blüte von Cymbalaria muralis (Plantaginaceae), links frontal gesehen, rechts längs aufgeschnitten

Foto: UHH/Rohwer
Früchte von Plantaginaceae; links septizide Kapseln bei Digitalis purpurea, Mitte Porenkapseln bei Antirrhinum majus, rechts Deckekapseln bei Plantago lanceolata

Foto: UHH/Rohwer
Wasserpflanzen bei den Plantaginaceae: links Hippuris vulgaris, rechts Callitriche spec.

Foto: UHH/Rohwer
Blätter von Apiaceae, links einfach gefiedertes Blatt von Helosciadium nodiflorum, rechts mehrfach gefiedertes Blatt von Chaerophyllum bulbosum

Foto: UHH/Rohwer
Oberes Stängelblatt von Angelica sylvestris, mit großer Blattscheide

Foto: UHH/Rohwer
Typische Doppeldolde der Apiaceae (Laserpitium siler)

Foto: UHH/Rohwer
Infloreszenz der Apiaceae; links Verzweigung der Dolde 1. Ordnung, mit Tragblättern der Doldenstrahlen ("Hülle") von Conium maculatum, rechts Dolde 2. Ordnung ("Döldchen"), mit Tragblättern der Doldenstrahlen ("Hüllchen") von Anthriscus sylvestris

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Apiaceae, von oben gesehen; links Kümmel (Carum carvi), rechts Dill (Anethum graveolens)

Foto: UHH/Rohwer
Früchte einiger Apiaceae; von links nach rechts Anthriscus sylvestris, Carum carvi, Angelica sylvestris, Scandix pecten-veneris

Foto: UHH/Rohwer
Blätter von Campanulaceae; links Campanula rotundifolia, rechts Phyteuma spicatum

Foto: UHH/Rohwer
Infloreszenzen von Campanulaceae; links Traube bei Campanula rapunculoides, Mitte Ähre bei Phyteuma spicatum, rechts köpfchenartige Dolde bei Jasione montana

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Campanula persicifolia, links seitlich, rechts nahzu frontal gesehen

Foto: UHH/Rohwer
Blüte von Lobelia erinus, links frontal, rechts seitlich gesehen

Foto: UHH/Rohwer
Kapseln von Campanulaceae; links Campanula persicifolia, mit distalem Porus bei aufrechten Kapseln, rechts C. rapunculoides, mit proximalem Porus bei hängenden Kapseln

Foto: UHH/Rohwer
Blätter einiger Asteraceae; links Scorzonera hispanica, Mitte Achillea millefolium, rechts Cirsium dissectum

Foto: UHH/Rohwer
Blütenköpfchen verschiedener Asteraceae; links nur mit Zungenblüten (Cichorium intybus), Mitte mit Zungen- und Röhrenblüten (Tripleurospermum maritimum), rechts nur mit Röhrenblüten (Cirsium oleraceum)

Foto: UHH/Rohwer
Blick auf den Rand eines Blütenköpfchens von Helianthus annuus; bei den vordersten Blüten entfaltete Narbenäste erkennbar, dahinter Antherenröhren

Foto: UHH/Rohwer
Schnitt durch ein Blütenköpfchen von Leucanthemum vulgare

Foto: UHH/Rohwer
Blüten von Leucanthemum vulgare, links Zungenblüte, Mitte Röhrenblüte in männlicher Phase, rechts Röhrenblüte in weiblicher Phase

Foto: UHH/Rohwer
Fruchtendes Köpfchen von Senecio inaequidens
61-712 Freilandbiologisches Praktikum (botanischer Teil)
Angela Niebel-Lohmann, Jens G. Rohwer
Von Biologie-Lehrern wird allgemein erwartet, dass sie sich in der Natur auskennen. Sogar in einer Stadt wie Hamburg ist die Vielfalt weitaus größer als die meisten Bewohner wahrnehmen. Auf kleinen Exkursionen (beinahe eher Freiluft-Vorlesungen) zeigen und erklären wir Ihnen die häufigsten und auffälligsten Pflanzenarten Hamburgs sowie zahlreiche Besonderheiten in ausgewählten städtischen und naturnahen Lebensräumen im Hamburger Raum. Dabei erläutern wir nicht nur die Lebensbedingungen in den aufgesuchten Gebieten, sondern machen sie oft auch physisch erfahrbar.

Foto: UHH/Rohwer
Gewöhnliche Haselnuss (Corylus avellana), links Blütenstände, Mitte jungerAustrieb, rechts Zweig mit unreifen Früchten

Foto: UHH/Rohwer
Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), links Blüten, rechts Blatt mit axillärem Sprossdorn

Foto: UHH/Rohwer
Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora), Blüten frontal und seitlich gesehen

Foto: UHH/Rohwer
Erlenbruchwald bei Prisdorf

Foto: UHH/Rohwer
Stieleiche (Quercus robur), Zweigspitze mit jungen Blütenständen

Foto: UHH/Rohwer
Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum), Blatt im Gegenlicht

Foto: UHH/Rohwer
Sauerklee (Oxalis acetosella)

Foto: UHH/Rohwer
Naturschutzgebiet Boberger Düne, auf der großen Düne

Foto: UHH/Rohwer
Laubwald bei Prisdorf

Foto: UHH/Rohwer
Einbeere (Paris quadrifolia); eine der wenigen Monocotylen mit netznervigen Blättern

Foto: UHH/Rohwer
Heidelandschaft im NSG Boberger Düne

Foto: UHH/Rohwer
Naturschutzgebiet Schnakenmoor

Foto: UHH/Rohwer
Kletten-Labkraut (Galium aparine), unreife Früchte

Foto: UHH/Rohwer
Vogelmiere (Stellaria media), links Sprossspitze mit Blüte, rechts Stängel mit der charakteristischen einreihigen Behaarung
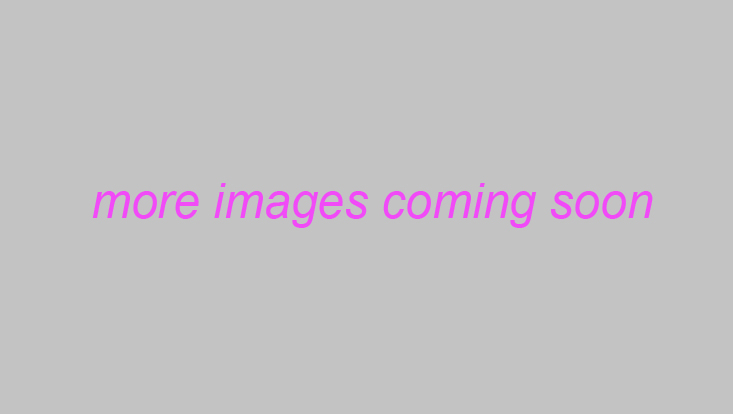
Foto: UHH/Rohwer
weitere Bilder in Vorbereitung ...
Link zu den Exkursionsvideos
Einige kurze Exkursionsvideos finden Sie hier: https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/51460
